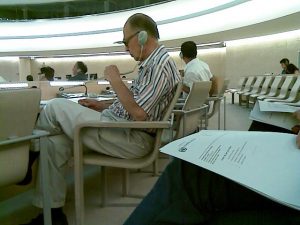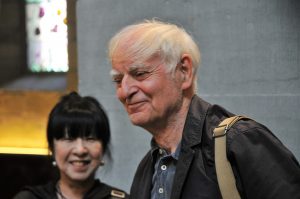Grösste Steuererleichterung in der Geschichte der Schweiz
Die Unternehmenssteuerreform III ist eine der grössten Steuererleichterungen für die bislang ordentlich besteuerten juristischen Personen, welche die Schweiz je gesehen hat. Der Anlass für die USR III ist ein gerechter: Bisher privilegierte Firmen sollen gleich behandelt werden wie alle Firmen in der Schweiz. Das ist gut und richtig so. Nur werden die bisher bevorzugten Firmen nicht einfach so viel bezahlen müssen, wie alle anderen zuvor. Sondern alle werden weniger bezahlen müssen. Die Umsetzung der USR III ist so verheerend. Es stellen sich grundsätzliche Fragen: Welches sind die empirischen und politischen Argumente für die USR III? Was sind die sozialethischen Folgen? Was bedeutet dies für die Landeskirchen? Und welche Strategien sollen die kirchlichen Organe (SEK; Kirchenrat, Kirchgemeinden, Pfarrvereine und Pfarrkapitel, Diakonatskapitel, MusikerInnen, Verbände von kirchlichen Mitarbeitenden, etc.) einnehmen?
Politisches Argument: „Wir müssen uns gegen unten anpassen“.
Es ist unbestritten, dass das Steuersystem angepasst werden muss. „Nichtstun wäre noch viel gravierender“ sagt der Steuerexperte Peter Uebelhart in der NZZ[1]. Der Wegfall der bisherigen Privilegien ist zwingend, da so Steuerausfälle in den Ursprungsländern entstanden sind. Es ist daher nachvollziehbar, dass die OECD auf die Einhaltung von internationalen Standards pocht. Die Schweiz ist wohl zu Recht ins Visier geraten, da das internationale Ziel der Vermeidung von base erosion and profit shifting (Beps) für alle Beteiligten sinnvoll ist. Es stellt sich nun die Frage, ob die vom Bundesparlament gewählten Instrumente sinnvoll sind. Wird hier der Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben?[2]
Politisch-ökonomisches Argument: „Die Firmen ziehen ab“
Das Hauptargument für eine Nicht-Hinaufsetzung der bisher privilegierten Firmen auf das Niveau, das alle anderen Firmen im bisher unbestrittenen Konsens zahlen, heisst, dass die bis anhin bevorzugten Firmen sonst ins Ausland abziehen würden. Das glaubt etwa CVP-Nationalrat Leo Müller.[3] Hier stellt sich die Frage, ob dieses Argument ethisch stringent ist. Dies ist es nicht. Zu sagen: „Wenn ihr uns andere Regeln gebt, dann gehen wir“ ist kein ethisches Argument. Selbstverständlich besteht das Recht zu gehen. Die Frage ist, ob sich der Gesetzgeber von diesem Argument beeinflussen lassen darf. Damit übernähmen die Unternehmungen eine Stellung, die ihnen im Staatsgefüge nicht zukommt. Gesetzgebung ist Sache der gewählten Repräsentanten.
Ob die Steuern gerecht sind oder nicht, hängt nicht davon ab, ob eine Firma sie bezahlen will oder nicht, ob sie drohen, wegzuziehen oder nicht. Sondern, ob sie für soziale Gerechtigkeit und Ausgleich sorgen oder eben nicht. Wenn Firmen wie Glencore, Apple und Amazon ihre Steuern global versteckt haben, so wächst nun Widerstand. Die ethische Frage der Steuergerechtigkeit wird gestellt. So titelt das Wirtschaftsmagazin Bilanz: „Steuern: Am Fiskus vorbei. Sie minimieren trickreich ihre Steuerlast: Apple, Amazon, Glencore und andere multinationale Konzerne. Doch nun wächst der Widerstand. Steuergerechtigkeit wird zum Wahlkampfthema.“[4]
Wegzug wohin? Dekonstruktion eines Mythos
Lassen wir den Mythos, dass Firmen aus der Schweiz abziehen würden, für einen Moment als wahr erscheinen. Stellen wir uns die Frage, wohin denn diese Firmen ziehen wollten. So sagt Herr Uebelhart zu recht: „Man muss sich bewusst sein, dass die Schweiz ein solches Steuergesetz heute nicht mehr in Isolation schreibt, sondern unter enger Beobachtung der OECD“[5]. Wie das Beispiel von Apple in Irland zeigt[6], will die OECD, dass in Zukunft global dort die Steuern bezahlt werden, wo gearbeitet, geforscht, produziert wird. Mittel- und langfristig sind also alle Länder angehalten, Steuergerechtigkeit umzusetzen. Wer trotzdem in eine kleine Steueroase irgendwohin in der Welt ziehen will, hat zwangsweise etwas zu verstecken und muss sich die Frage stellen lassen, was denn. Ob dies dem Image der Firma zuträglich ist, mag bezweifelt werden.
Steuern nur Faktor an siebter Stelle
Kommt dazu, dass die Steuern nur ein untergeordneter Faktor (Rang sieben) von vielen Standortfaktoren sind. Wichtig sind Rechtssicherheit, öffentlicher Verkehr, Schulwesen, Gesundheitswesen, Kultur, liberale Religionsausübung etc. Bei einer Umsetzung der USR III entgehen der öffentlichen Hand, und den Kirchen, jedoch genau für diese Aufgaben grosse Mittel.
Fakt ist: Firmen investieren und bleiben
Hier gilt es ruhig festzustellen: entgegen der unablässig widerholten Drohung, Firmen würde abwandern, wollen grosse Firmen gar nicht wegziehen. Im Gegenteil: Sie investieren in die Zukunft. So berichtet Stadtrat Daniel Leupi: „Trotz der im kantonalen Vergleich überdurchschnittlich hohen steuerlichen Belastung boomt die Wirtschaft. Firmen wie Swiss Re, UBS, CS oder die Zurich haben in den letzten Jahren Hunderte von Millionen in Neu- und Ausbauten ihrer Hauptsitze in Zürich gesteckt. Ein klares Bekenntnis zum Standort Zürich – unabhängig vom Steuerfuss“. Dies gilt es im Kopf zu behalten, wenn allenfalls Kirchen vorgeworfen würden, bei ihrer Unterstützung des Referendums gegen die USR III, sie wären „gegen die Wirtschaft“ und „für die Zerstörung von Arbeitsplätzen“[7].
Mythos: „Firmen kommen“ – Einnahmen steigen“. Beides ein Misserfolg
Das schon erwähnte Hauptargument für die USR III wird mit einem weitere verbunden: „Wir müssen etwas tun, damit Firmen nicht abziehen. Und wir müssen schauen, dass neue Firmen herziehen. Es wird zwar eine kurze Baisse der Steuereinnahmen geben. Der Zuzug von Firmen wird den Ausfall mittelfristig ausgleichen, schliesslich sogar übertreffen“. Beide Argumente bedienen einen neoliberalen Mythos, den es mit aller Klarheit und Faktenschärfe zu dekonstruieren gilt.
Der Kanton Luzern hat die Unternehmensgewinnsteuer im Jahr 2012 auf 12 Prozent gesenkt.[8] Die Steuereinnahmen entwickelten sich nicht wie erwünscht: „2011, vor der Steuersenkung, betrugen sie 141 Millionen Franken, danach 94 Millionen (2012), 114 Millionen Franken (2013), 110 Millionen (2014) und 93,9 Millionen im letzten Jahr.“ Die Folge davon war ein fataler Sparkurs: „Zwangsferien für 20’000 Luzerner Schüler, die landesweit höchsten Schulgelder für Mittelschüler oder die neue, komplett von Firmen finanzierte Wirtschaftsfakultät. Obwohl Luzern bereits 200 Millionen Franken eingespart hat, fehlen in den kommenden drei Jahren rund 330 Millionen Franken.“ Wirtschaftsprofessor Marius Brülhart von der Uni Lausanne analysiert: «Aus der Warte der Steuereinnahmen handelt es sich um einen ziemlich klaren Misserfolg. Was die öffentlichen Einnahmen betrifft, wäre der Kanton wohl am besten gefahren, wenn er die Unternehmenssteuern überhaupt nicht gesenkt hätte.»[9] Diese Einsicht wiederholte Professor Brülhart im Tages-Anzeiger vom 8. Oktober[1]. Es habe zwar Firmenzuzüge und somit Zusatzeinnahmen bei den Einkommenssteuern gegeben, aber diese vermochten die Ausfälle bei den Steuern und beim Finanzausgleich nicht wettzumachen.
Kein Mythos, sondern Fakt: Ausfall zahlt Mittelstand
Was hingegen Fakt ist, ist, dass der Mittelstand und die Stadt Luzern die Zeche bezahlen: Höhere Schulgelder und Zwangsferien. Genau dieser Mechanismus droht bei der Einführung der USR III: entweder werden Leistungen wie für Schulen, Spitäler und öffentlicher Verkehr gestrichen. Oder die Steuern für natürliche Personen steigen. Das heisst: die Städte und die Gemeinden bezahlen die Zeche. Und die Kirchen.
Steuern in den wirtschaftsliberalen USA bis 40 Prozent
Ein Argument für die USR III ist, dass behauptet wird, dass die Steuerlast in der Schweiz für Firmen hoch sei. Dies ist schlicht nicht richtig. So besteuern die USA in Kalifornien Unternehmen bei 39 Prozent: „Tatsächlich besteuern weltweit nur gerade die Vereinigten Arabischen Emirate (55%) und Tschad (40%) die Einnahmen von Unternehmen stärker als die USA, wie eine Analyse des Think-Tanks Tax Foundation zeigt. Der Durchschnitt von 163 untersuchten Ländern beträgt derweil 22,6%. Der Schweizer Satz liegt laut OECD-Daten leicht darunter bei 21%“ [10]
Auch diese Firmen „drohen“, Silikon Valley zu verlassen. Tatsache ist: kaum eine dieser Firmen hat ihren Standort verlassen. Wohin sollten sie auch gehen? Allenfalls kämen sie – nach Zürich! In die Schweiz! Hier treffen sie auf tiefe, international kompetitive 21 % Steuerlast. Hier treffen sie auf eine anerkannt sehr gute Infrastruktur und Kultur, welche Zürich, welche die Schweiz, dank fairen und gerechten Steuern, der Allgemeinheit zur Verfügung stellt. Auch durch den Beitrag, den die Firmen mit ihren Steuern verdankenswerter- und gerechterweise beitragen.
Wohin gehen die verschenkten Gelder? Mehrheitlich ins Ausland
Sozialethisch ist von grosser Bedeutung, wohin die nicht mehr eingeforderten Steuer-Milliarden mit den Mitnahmeeffekten wandern. Die schlichte Antwort lautet: Der grösste Teil geht direkt ins Ausland. Die grossen Firmen in der Schweiz sind zwischen 50 bis 70 Prozent in der Hand eines ausländischen Aktionariates[11]. Die eingesparten Steuern erhöhen direkt den Gewinn dieser Firmen und damit deren Möglichkeit, Dividenden auszuschütten. Die Dividenden wandern also zu 50 bis 70 Prozent sogleich ins Ausland. Der Lausanner Wirtschaftsprofessor Marius Brülhart sagt dazu: „Übers Ganze gesehen ist davon auszugehen, dass die USR III eine leichte Umverteilung der Steuerlast von oben nach unten nach sich ziehen wird – denn entlastet werden in erster Linie Aktionäre grosser und rentabler Firmen.“[12] Leicht? 15 bis 20 Millionen für die Zürcher Landeskirche? 200 bis 300 Millionen für die Stadt Zürich?
„Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist.“ Eine Frage der Steuergerechtigkeit
Ein Ziel einer nachhaltigen Steuerpolitik sollte die Gleichbehandlung aller Branchen sein. Es ist nicht einzusehen, weshalb gewisse Branchen (z.B. neu der IT-Bereich) ihre Erträge von bis zu 90% von der Besteuerung ausnehmen können sollen, während andere Branchen vollumfänglich besteuert werden. Insofern gilt es ernsthaft zu bedenken, ob irgendwelche Steuern gesenkt werden sollen. Wie schon erwähnt: Die Schweiz ist mit 21 % leicht unter dem Durchschnitt von 163 Ländern. Ethisch kann selbstbewusst vertreten werden: „Die Unternehmensgewinnsteuern sind gerecht. Sie tragen zu einem liberalen und funktionierenden Staat bei. Sie müssen von allen Unternehmen ohne Ausnahme bezahlt werden. Die Unternehmen tragen damit zu einem rechtstaatlich stabilen und verlässlichen Staat bei, von dem die Unternehmen selbst wieder profitieren.“ Dass diese Argumentation auch langsam in den USA greift (mit Steuersätzen bis 39%), wurde oben schon erwähnt (siehe Artikel Bilanz.)
Folgen für den Kanton Zürich
Die USR III bedeutet für den Kanton Zürich das historisch grösste Steuergeschenk an die juristischen Personen. Bis zu einer Milliarde Franken jährlich werden dem Kanton und den Gemeinden wahrscheinlich fehlen. Diese Zahlen sind zwar noch nicht erhärtet und beruhen auf den Aussagen von Daniel Leupi in der NZZ. fehl Dies ist vor allem dem sogenannten „Mitnahmeeffekt“ geschuldet. Firmen, die bis anhin gar nicht von Steuervergünstigungen betroffen waren, kommen nun auf einen Schlag ebenso Steuervergünstigungen. Der Zürcher SVP Regierungsrat sagt dazu: „Der Mitnahmeeffekt ist unbestritten gross. […] Niemand gibt gern so viel Geld her“.
Den finanziellen Ausfall für den Kanton Zürich wird Stadtzürcher Finanzvorstand für die Stadt Zürich auf 300 Millionen Franken geschätzt. Regierungsrat Stocker hält diese Zahl für übertrieben, hat bis jetzt jedoch noch keine Zahlen genannt. Fest steht aber für beide: Den Ausfall müssen vor allem die Gemeinden und die Städte bezahlen. Bei ihnen fallen mindestens ein Viertel der Steuern von juristischen Personen weg. Dies ist dem schon genannten „Mitnahmeeffekt“ geschuldet.
Auch Gemeinden und Konferenz der städtischen Finanzdirektoren dagegen
Der Verband der Gemeindepräsidenten im Kanton Zürich, der weitgehend von bürgerlichen Politikern geführt wird, wehrt sich deshalb gegen diese Steuerausfälle[13]. Sie sagen, dass ihnen so nur zwei Möglichkeiten bleiben: Entweder die Steuern für die natürlichen Personen erhöhen, oder die Leistungen kürzen. Dasselbe gilt für die Städte. „Die Konferenz der städtischen Finanzdirektoren ist bürgerlich dominiert – und sagt Nein zur USR III“[14]. So titelt ein Beitrag auf SRF. Die Einsicht setzt sich durch, dass die Städte, wie die Gemeinden, die Hauptlast der Kürzungen tragen müssen, und dies unabhängig davon, welche politische Ausrichtung die jeweilige Stadtregierung hat. Und wo bleiben die Kirchen?
Folgen für die Landeskirchen: grosse Verluste bei Diakonie und Kultur
Bei all diesen Argumenten ist nun von Seite Landeskirchen zu tiefst zu bedauern, dass sie bis jetzt kaum in den Blickwinkel der Argumentationen gekommen sind. Denn sie sitzen im gleichen Boot wie die politischen Gemeinden. Den Landeskirchen im Kanton Zürich zum Beispiel wird, mit einem Schlag, mindestens ein Viertel ihrer Steuern von juristischen Personen wegfallen. Der Stadtverband der Reformierten Kirchen in Zürich rechnet mit einem Rückgang von 8 bis 10 Millionen Franken[15]. Die Landeskirche des Kantons Zürich rechnet insgesamt mit 15 bis 20 Millionen Franken[16]. Da diese Steuern nicht für Kultuszwecke, sondern nur für diakonische und kulturelle Zwecke verwendet werden dürfen, trifft der immense Ausfall vor allem die Schwachen in der Gesellschaft. Es sind deshalb vor allem die diakonischen Aufgaben, welche die Kirchen für die Allgemeinheit ausführen, gefährdet: Familienarbeit, Jugendintegration, Flüchtlingsarbeit, Betreuung in Altersheim, Spitalseelsorge, Notfallseelsorge, Besuchsdienste, Beratungszentren, etc. Ebenso werden unweigerlich die vielfältigen kulturellen Angebote überproportional unter der USR III leiden müssen. Zudem muss überdacht werden, ob Kirchen „geschlossen oder verlottern gelassen“ werden sollen.[17]
Mit Spareffekten nicht auszugleichen
All diese Kürzungen können mit Sparanstrengungen niemals aufgefangen werden. Auch den Kirchgemeinden bleiben so nur die beiden Möglichkeiten, wie sie den Gemeinden und Städten bleiben: Steuererhöhung oder Leistungsabbau. Da Steuererhöhung alle natürlichen Personen betreffen, kann mit Fug und Recht gesagt werden: Die Zeche zahlt der einfache Bürger, das normale Kirchenmitglied.
Welche Strategien für die Kirchen?
Die Kirchen sind leider noch kaum in den Blick als Leidtragende der Umverteilung der USR III gekommen. Weder im Gespräch zwischen Stadtrat Leupi und Regierungsrat Stocker wurden von den Konsequenzen für die Kirchen gesprochen. Auch im neuesten Bericht im Tages-Anzeiger vom 6. Oktober über die USR III[18], werden die Kirchen von keiner Partei mit einem Wort erwähnt. So stellt sich die Frage der Strategien, welche sie anwenden sollen. Kirchgemeinden und Kantonalkirchen sind sich nicht gewohnt, in Fragen der Bundespolitik Stellung zu nehmen. Die Gefahr dabei ist, dass man sich den Schwarzen Peter gegenseitig zu schiebt. Hier muss aber für alle Stufen der Kirchen gelten: „Niemand wird es für die Kirchen richten“[19].
Kirchen leider noch kaum im Blick
Bis jetzt wurden den Kirchen im Kanton Zürich keine Ausgleichszahlungen vorgeschlagen. Anders in Bern: Dort hat der Regierungsrat gesehen, dass die Kirchen sehr unter den Abstrichen zu leiden hätten, und hat einen Ausgleich vorgeschlagen[20]. Diese werden jedoch bei weitem nicht die Verluste decken. Immerhin wurde dort mit den Kirchen buchstäblich gerechnet. Biel würde ein Viertel seines Budgets verlieren. Deshalb unterstützt Biel das Referendum.
Ein Teufelskreis: direkte Kantonsbeiträge
Die Kirchen müssen, zumindest im Kanton Zürich, noch mit einer weiteren Senkung rechnen: die direkten Kantonsbeiträge an die Landeskirchen. Die sind bekanntlich abhängig von den neu gemessenen und erhobenen Leistungen in Diakonie und Kultur. Sinken diese Leistung infolge der USR III, sinken auch die erhobenen und gemessenen Leistungen. Sinken diese, so sinken auch die Kantonsbeiträge. Ein Teufelskreis, der nur die Kirchen betrifft!
Froh und dankbar um Steuern? – Ja! Behalten wir es bei!
Eine Strategie des „vorauseilenden Gehorsams“ ist die Haltung, dass die Kirchen doch, bitte schön, dankbar für die Kirchensteuern der juristischen Personen sind und bleiben sollen. So sagt der Synodalratspräsident von Basel Land, Martin Stingelin, die Lust der Kirche sei klein, sich gegen die USR III zu stellen, „in erster Linie weil wir froh und dankbar sind für die Beiträge der juristischen Personen“[21]. Dankbar sind selbstverständlich alle Kirchen. Die Steuern, die nun gesenkt werden, waren aber gar nie in Frage gestellt worden. Alle sahen und sehen den Sinn der Steuern ein. Ethisch muss argumentiert werden: „Ja, auch wir Kirchen sind dankbar für diese wichtigen Steuern. Räumen wir deshalb alle ungerechten Privilegien aus, und halten wir an diesen Steuern für alle fest. Sie tragen für das Allgemeinwohl bei.“
Kein Öl ins Feuer? Kontraproduktiv? – Selbstbewusst hin- und einstehen!
Eine weitere kirchliche Strategie schenkt vorsichtigen Stimmen innerhalb der Landeskirchen Gehör, die sich vor einer klaren Stellungnahme gegen die jetzt USR III scheuen. So meint Daniel Kosch, Geschäftsführer der Römisch-Katholischen Zentralkonferenz der Schweiz, dass ein Engagement der Kirchen „kontraproduktiv“ sei. Das habe eine Mitgliederbefragung gezeigt. Es gehe den Kirchen da nur um sich selbst. Diese Strategie ist gefährlich. Denn: entweder geht es wirklich um einen Zehntel bis einen Viertel der Gelder der Kirchen. Dann sollen die das sagen dürfen und müssen. Oder aber sie sagen nichts. Damit geben sie ein Zeichen, dass es „schon irgendwie gehe“ und „auch die Kirchen ihren Beitrag entrichten müssten“. Dann kann und muss aber nachgefragt werden: „Wenn es ohne diesen Zehntel bis einen Viertel weniger im Budget geht, warum wartet ihr auf die USR III und spart nicht schon jetzt?“ Wenn die Kirchen nicht selbstbewusst, wie die politischen Gemeinden, hin stehen und ihre Verluste benennen können und dürfen, dann haben sie in dieser Debatte von Beginn weg verloren. So hätten sie dann wirklich selbst Öl ins Steuersenkungsfeuer gegossen.
Im selben Boot wie die politischen Gemeinden
Dass mit den Kirchen kaum je das Gespräch gesucht wurde, zeigt, dass auch sie im gleichen Boot wie die Gemeinden sitzen. Diese beklagen ihren Nichteinbezug. So sagt FDP Nationalrat Kurt Fluri, Präsident des Schweizerischen Städteverbandes: «Es wurde geradezu hochnäsig auf die Hierarchie zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden verwiesen. Es wurde gesagt, es sei Sache der Kantone, die Gemeinden zu berücksichtigen“[22]. Das gilt auch für die Kirchen: sie wurden (noch) kaum berücksichtig. Eine Strategie kann deshalb sein, nun das Gespräch mit den Kantonen zu suchen.
Fazit:
- Kirchgemeinden, Kantonalkirchen und der Kirchenbund sollten […] das Referendum gegen die USR III unterstützen“ rät Matthias Böhni[23]. Denn sie sind, noch mehr als die politischen Gemeinden, die grossen Verliererinnen in dieser geschichtlich grössten Umverteilung, welche die Schweiz je gesehen haben wird.
- Umgekehrt würde ein kirchliches stillschweigendes Akzeptieren dieser Umverteilung von Steuergeldern ins Ausland das Signal aussenden, dass die Kirchen sparen könnten. Dieses Signal wäre fatal und selbszerstörend. Aus Angst davor, dass es denn Kirchen selbst nur um den Mammon ginge, verteidigen sie nicht die liberal anerkannte gute Wirkung von sinnvoll eingesetztem Mammon und Geld. Das ist entweder feige oder dumm. Oder aber man verfällt so wirklich dem Mammon. Gott bewahre.
- Die Angst vor einer Diskussion um den Beitrag der juristischen Steuer an die Kirchensteuern ist unbegründet. Das Zürcher Stimmvolk hat eine entsprechende Vorlage der Jungliberalen vor zwei Jahren abgelehnt. Die Mehrheit ist einverstanden, dass die Firmen auch auf diese Art ihren Beitrag an die Allgemeinheit leisten. Alle Argumente der kirchlichen Kampagne „Sorge tragen“ gelten gerade und vor allem hier.
- Auch Landeskirchen und Kirchgemeinden, die nicht direkt betroffen sind, sollten sich in Solidarität mit den stark betroffenen Kirchen zeigen.
- Die geschichtlich grösste Umverteilung von unten nach oben und vom Inland ins Ausland wird hauptsächlich von den politischen Gemeinden, den Städten – und den Kirchen getragen. Damit zahlen die Schwächsten der Gesellschaft, für welche die Kirchen mit ihrem Wächteramt seit je eintreten, die Zeche. Das ursprüngliche, ethisch sinnvolle Ziel gegen das BEPS, das base erosion and profit shifting, wird in sein Gegenteil verkehrt. Der Teufel wird mit dem Beelzebub ausgetrieben. Das angebotene Mittel gegen das BEPS erzeugt eine dramatische Erosion an der Basis. Und der Profit wird ins Ausland verschifft. Das ist sozialethisch und liberal schlicht untragbar.
Mit der Annahme des Referendums müssen der Nationalrat und der Ständerat nochmals über die liberal-sozialethischen Bücher. So könnten sie von Beginn weg auch die Kirchen in den Blick nehmen. So kann die sozialethisch entscheidende Frage neu gestellt werden, wer die Zeche bezahlen wird. Oder ob notwendige Steuergerechtigkeit nicht mit einer Reform gelöst werden kann, in der nicht die Schwächsten die Zeche bezahlen müssen.
Pfarrer Res Peter
Präsident prolibref Zürich, Zürcher Verein für freies Christentum
Vorstandsmitglied libref Schweiz
Zürich, 6. Oktober 2016
[1] NZZ vom 27. Juni 2016, siehe http://www.nzz.ch/zuerich/aktuell/unternehmenssteuerreform-iii-in-zuerich-nichtstun-waere-noch-viel-gravierender-ld.91782
[2] Siehe Denknetz, Unternehmenssteuerreform III: Die Austreibung des Teufels mit dem Belzebub: Denknetz, Jahrbuch 2014, 197–205. http://www.denknetz-online.ch/sites/default/files/baumann-unternehmenssteuerniii-jahrbuch_denknetz_14-14.pdf
[3] Siehe den Beitrag auf SRF:
http://www.srf.ch/news/schweiz/unternehmenssteuerreform-iii-kirchen-bangen-um-pfruende
[4] Bilanz, 19. 5. 2012. http://www.bilanz.ch/unternehmen/steuern-am-fiskus-vorbei
[5] NZZ vom 27. Juni.
[6] Die Zeit, 2. 9. 2016. Siehe http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-09/wolfgang-schaeuble-finanzminister-steuernachzahlung-apple-irland-eu-kommission
[7] NZZ vom 2. September 2016. Siehe http://www.nzz.ch/zuerich/aktuell/unternehmenssteuerreform-iii-so-viel-geld-gibt-niemand-gerne-her-ld.114344
[8] Tages Anzeiger vom 5. September 2016, siehe http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Der-bange-Blick-nach-Luzern/story/23217872
[9] Ebd.
[10] NZZ vom 3. 9. 2014. Siehe http://www.nzz.ch/wirtschaft/us-firmen-auf-der-flucht-1.18375822
[11] Diese Angaben sind seit dem 1. Januar 2016 und dem Schweizer Finanzmarktinfrastrukturgesetz öffentlich. Sie können in Kleinarbeit zusammengetragen werden. So findet man auf der Homepage der UBS folgende Angaben: 18, 4 % Prozent der Aktien sind in Schweizer Hand. 81,6 Prozent in sind in ausländischer Hand. Das heisst, die Dividenden der Aktien der UBS fliessen zu 81, 6 Prozent ins Ausland. Siehe https://www.ubs.com/global/de/about_ubs/investor_relations/share_information/shareholder_details/distribution.html#par_title_2
[12] Michael Soukup und Stefan Häne: „SP fordert Kompensation für Steuerausfälle“ Tages-Anzeiger, 6. Oktober 2016, S. 8. Siehe http://www.tagesanzeiger.ch/zeitungen/linke-wollen-gegengeschaeft/story/21253424
[13] „Die Befürchtungen von Städten und Gemeinden bewahrheiten sich. Unternehmenssteuerreform III (USR III) im Kanton Zürich: Steuerausfälle von 400 Millionen für Städte und Gemeinden zu erwarten“ Verband der Gemeindepräsidenten des Kantons Zürich, Medienmitteilung vom 26. Juni 2016. siehe http://www.gpvzh.ch/dl.php/de/57752b10e0ee4/16_06_30_-_USR_III_-_MM_DEF.pdf
[14] http://m.srf.ch/news/schweiz/ein-ausdruck-der-geringschaetzung
[15] Matthias Böhni: „Warum die Kirchen das Kürzel «USR III» kennen sollten“, ref.ch vom 19. September, https://www.ref.ch/gesellschaft-politik/warum-die-kirchen-das-kuerzel-usr-iii-kennen-sollten/. Vgl. Matthias Böhni: „Und wer bezahlt die Zeche“, bref Nr. 18/ 30. September 2016, S. 20-22
[16] So der Zürcher Kirchenratspräsident Michel Müller im Interview mit Radio SFR am 16. September 2016 im Beitrag von Gaudenz Wacker „USR III – Besorgnis bei Landeskirchen“. Siehe http://www.srf.ch/news/schweiz/unternehmenssteuerreform-iii-kirchen-bangen-um-pfruende.
[17] Ebd.
[18] Michael Soukup und Stefan Häne: „SP fordert Kompensation für Steuerausfälle“ Tages-Anzeiger, 6. Oktober 2016, S. 8. Siehe http://www.tagesanzeiger.ch/zeitungen/linke-wollen-gegengeschaeft/story/21253424
[19] Matthias Böhni: „Zögern ist fehl am Platz“, bref Nr. 18/ 30. September 2016, S. 20
[20] So Reto Burren von der Finanzdirektion des Kantons Bern im Beitrag von Gaudenz Wacker (a.a. O.) Ebenso M. Böhni, ref.ch vom 19. September, a.a.O.
[21] Ebd.
[22] http://m.srf.ch/news/schweiz/ein-ausdruck-der-geringschaetzung
[23] „Zögern ist fehl am Platz“, Kommentar von Matthias Böhni, bref Nr. 18/ 30. September 2016, S. 21.